An Wissensinhalten, Praktiken, Aushandlungsformen und Vernetzungsdynamiken zeigt sich, wie sich virtuelle Lebenswelten entfaltet haben und diverse Formen der Virtualität zur treibenden Kraft für gesellschaftliche und kulturelle Transformationen geworden sind. Im Fokus der Reihe stehen Funktion und Folgen des Virtuellen für die Subjektkonstitution, für lebensweltliche und ästhetische Praxen, für soziale Organisationen und Operationen und nicht zuletzt für die Wissenschaften selbst.
Die am Sonderforschungsbereich beteiligten Fächer – Erziehungswissenschaft, Geschichtswissenschaft, Kunstgeschichte, Linguistik, Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft und Sozialwissenschaft – treffen sich in ihrer Forschung dort, wo es um die unterschiedlichen medialen und technischen Bedingungen virtueller Welten geht: Diese können erzählt, errechnet oder immersiv erfahren, modelliert oder imaginiert werden. Mit dem Begriff der Virtualität fokussiert die Schriftenreihe auf den Gebrauch von, den Umgang mit und die Teilhabe an möglichen Lebenswelten.


Verdeutlichungsoptionen unbestimmter Auftritte
Counter-forensics und die profondeur politischer Machtarchitekturen
Mehr Informationen
Auftreten in postdigitalen Mediengefügen
Foren und Protokolle
Mehr Informationen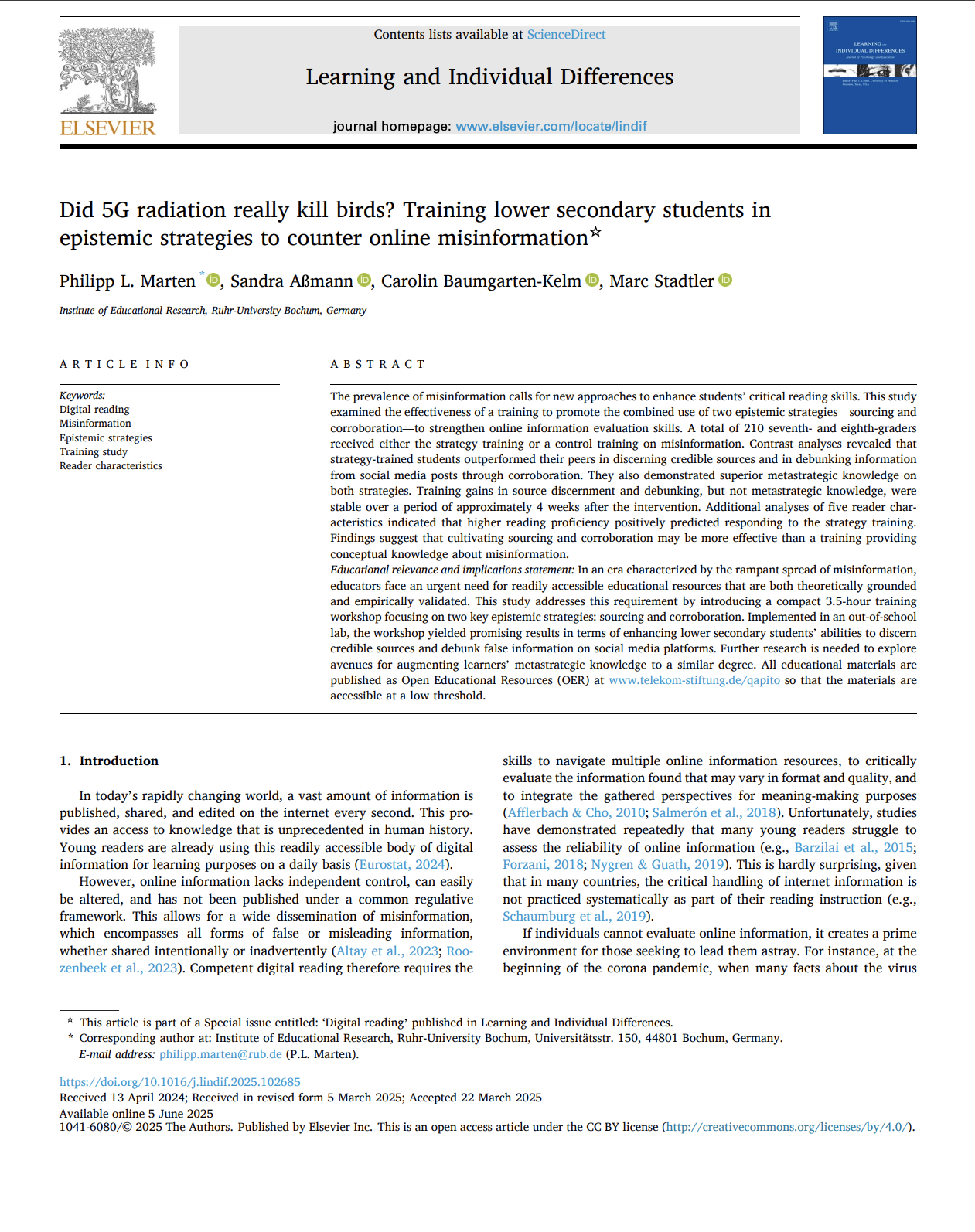
Did 5G radiation really kill birds?
Training lower secondary students in epistemic strategies to counter online misinformation
Mehr Informationen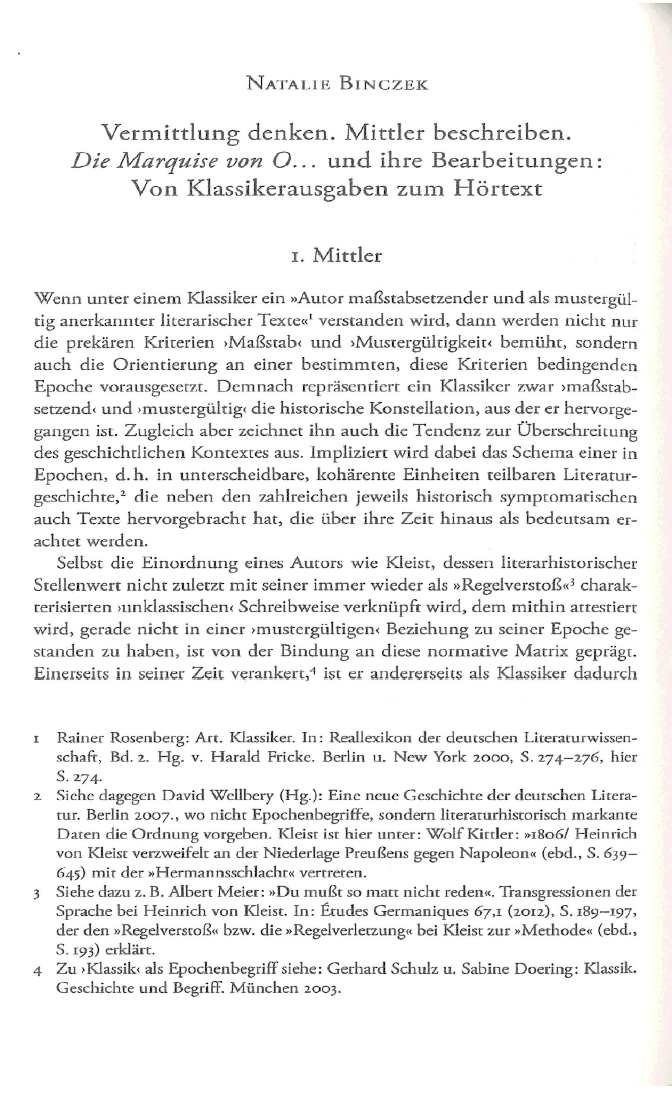
Vermittlung denken. Mittler beschreiben.
Die Marquise von O… und ihre Bearbeitungen: Von Klassikerausgaben zum Hörtext
Mehr Informationen
Ambiguous Relations
A Postphenomenological Reflection on Technological Multistability in Education
Mehr Informationen
Annotating candy speech in German YouTube comments
Mehr Informationen
Overview of the GermEval 2025 Shared Task on Candy Speech Detection
Mehr Informationen
Scalar Translation as a Method
Small Approaches to Scalability in Digital Cultures
Mehr Informationen
Het virtuele handschrift
Materialiteit en middeleeuwse boeken in VR
Mehr Informationen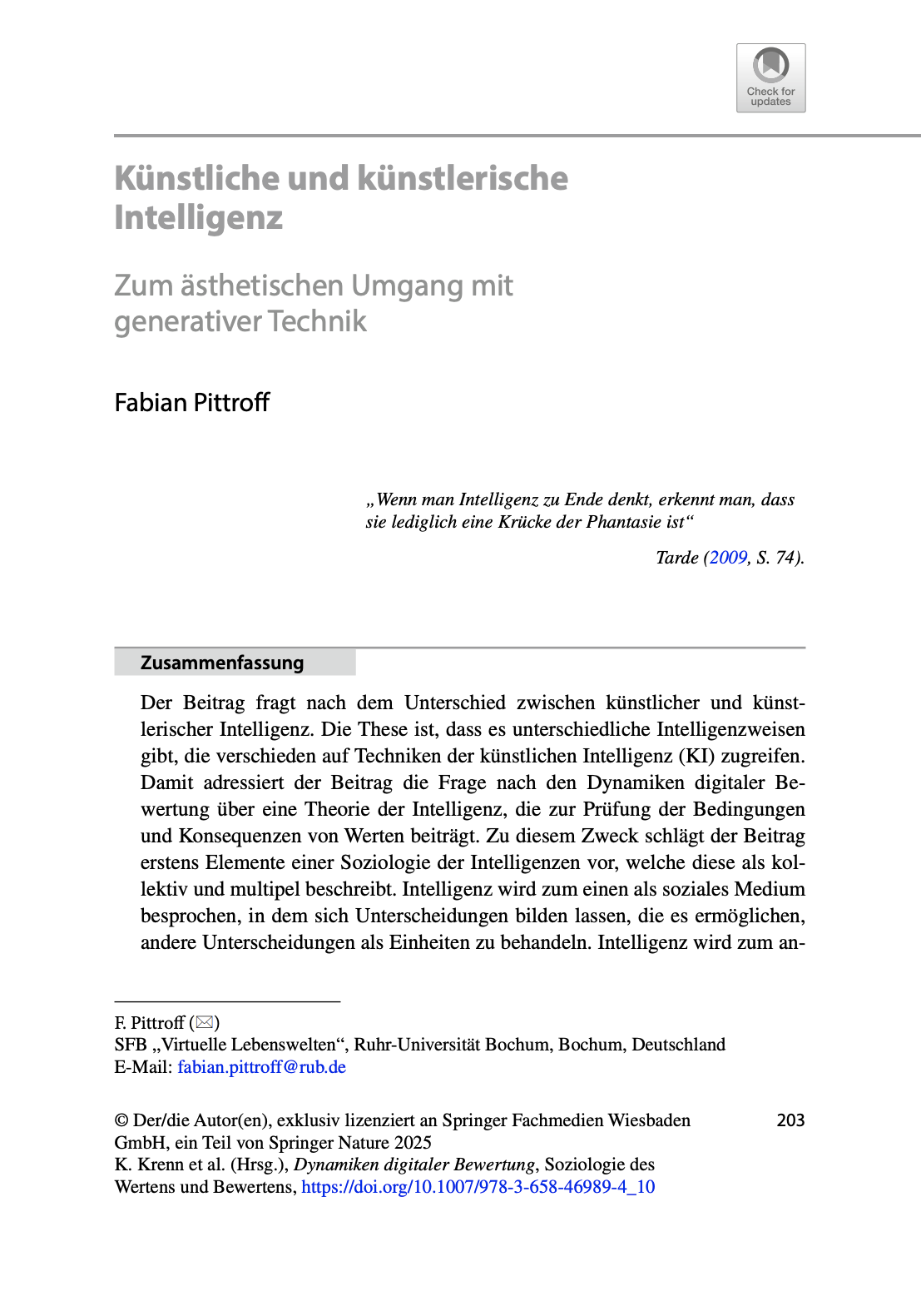
Künstliche und Künstlerische Intelligenz
Zum ästhetischen Umgang mit generativer Technik
Mehr Informationen
Critique of sensoric mediality
An experimental approach to chains of translation between the analog and the digital
Mehr Informationen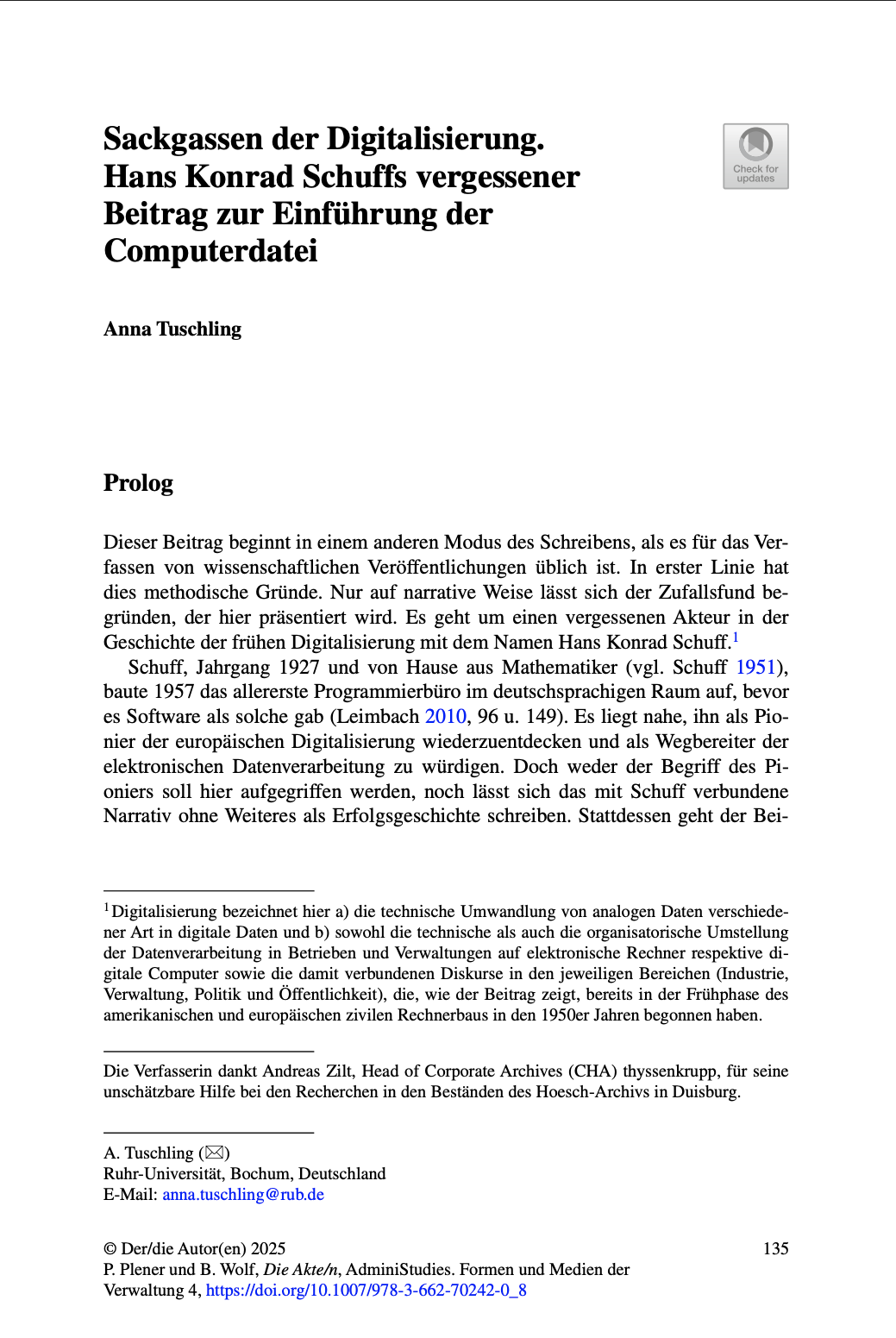
Sackgassen der Digitalisierung
Hans Konrad Schuffs vergessener Beitrag zur Einführung der Computerdatei
Mehr Informationen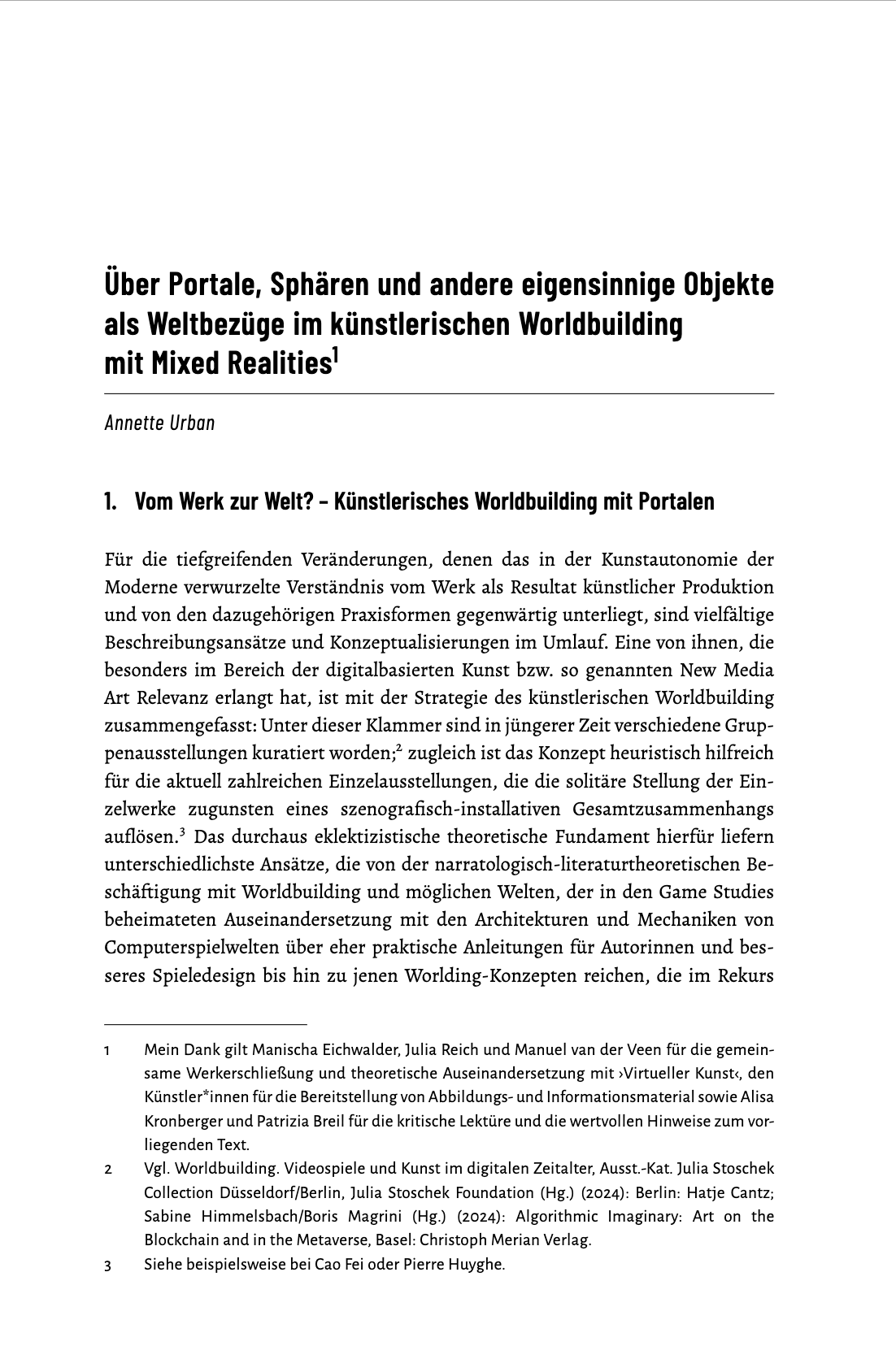
Über Portale, Sphären und andere eigensinnige Objekte als Weltbezüge im künstlerischen Worldbuilding mit Mixed Realities
Mehr Informationen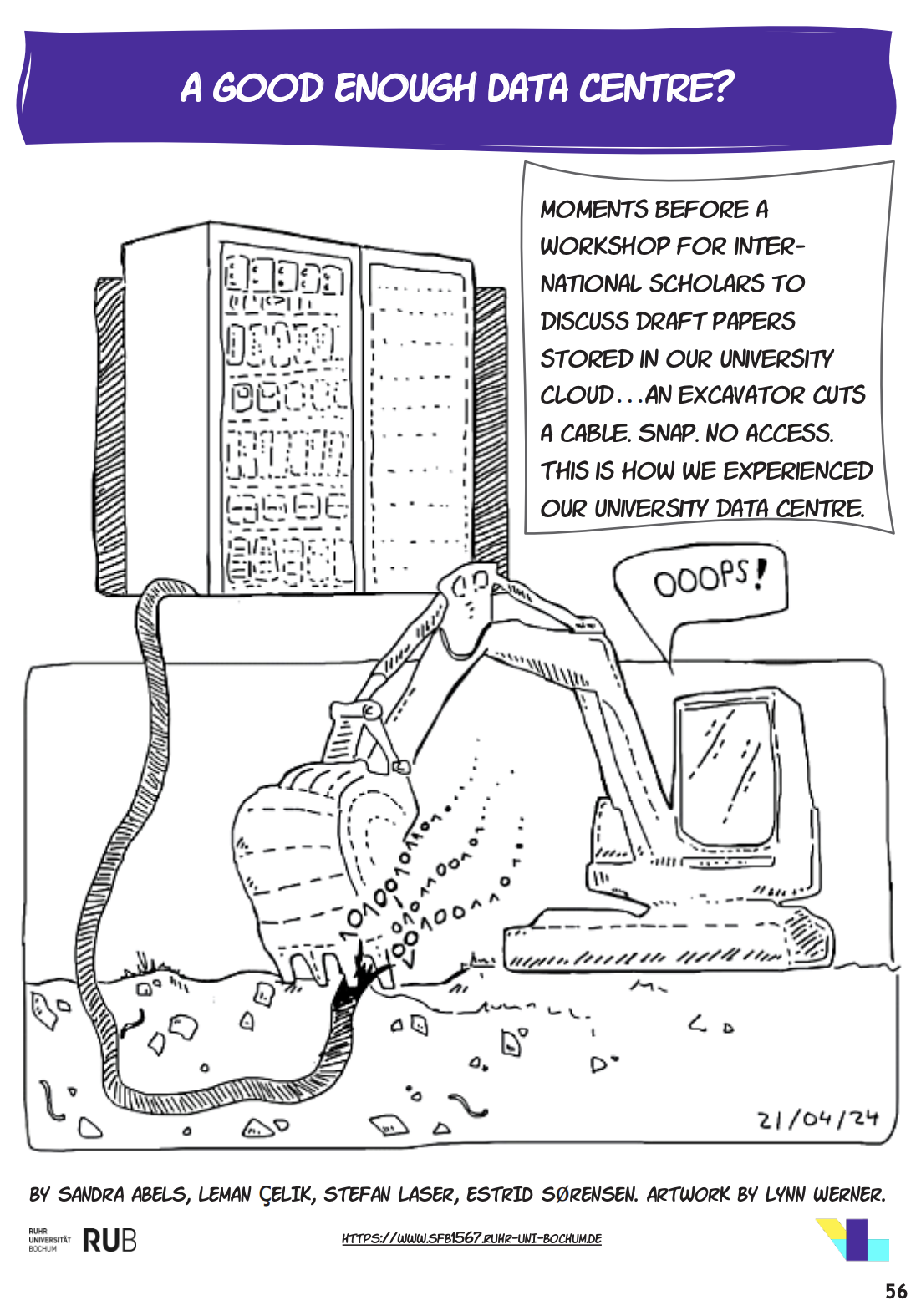
A Good Enough Data Centre?
Mehr Informationen
Lernprozessanregende Aufgaben in der Lehrkräftebildung
Förderung von Reflexions- und Medienkompetenz mit Fellinis „8 ½“
Mehr Informationen
Zwischen zwei Welten
Zum Verhältnis von Präsenz und Media Awareness während einer virtuellen Geländeführung
Mehr Informationen
Ansatzphänomene der Weltliteratur
Zur Verschränkung von close und distant reading bei Erich Auerbach
Mehr Informationen
»Nivellierte Jetztfolge« und »ekstatische Erstrecktheit«
Medien und Zeit nach Heidegger
Mehr Informationen
Dem Ohr eingeschrieben
Akustische Zitate und literarische Forensik bei Karl Kraus
Mehr Informationen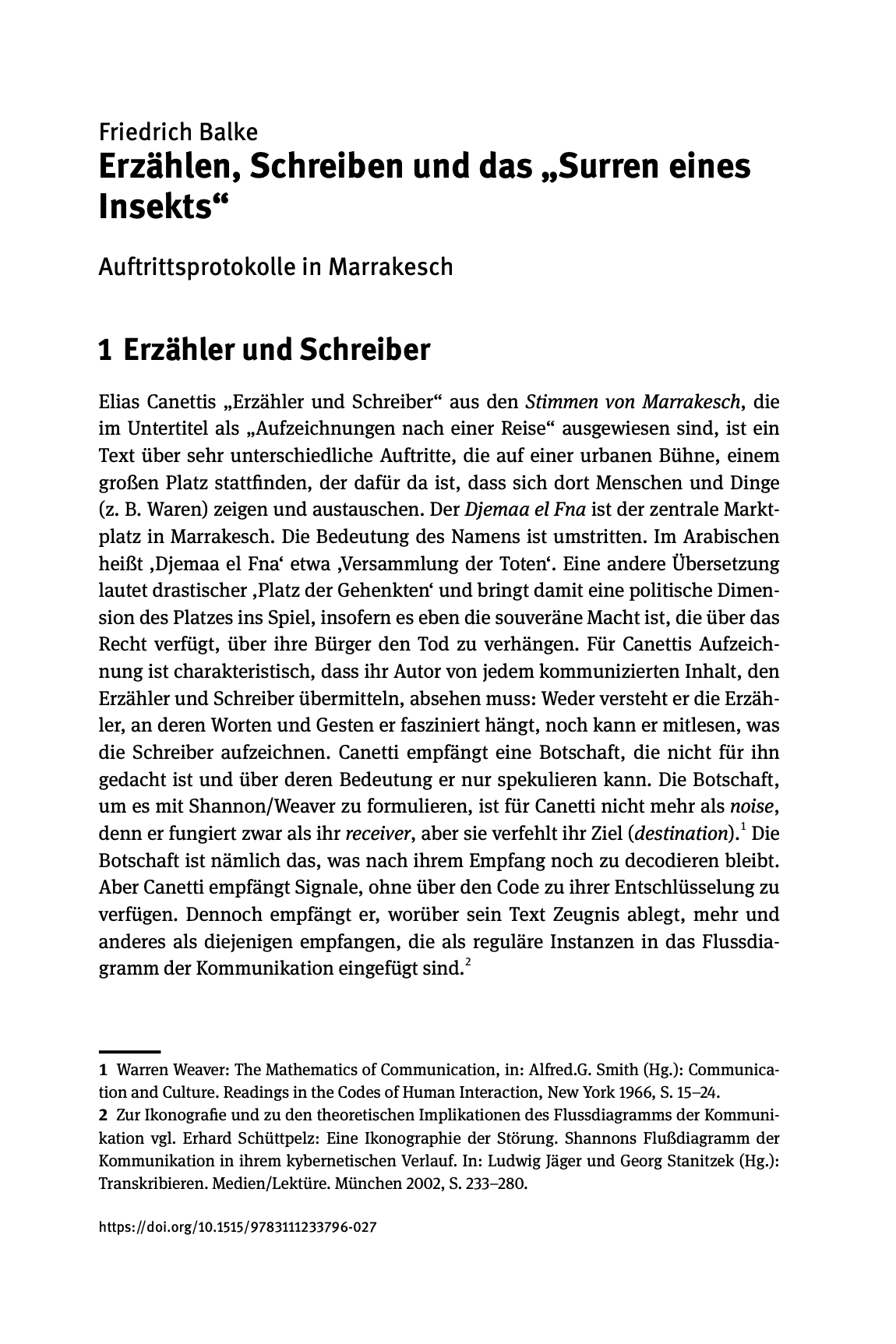
Erzählen, Schreiben und das „Surren eines Insekts“
Auftrittsprotokolle in Marrakesch
Mehr Informationen
Individuelle Anonymisierung oder anonyme Individualisierung?
Analoge, digitale und virtuelle Praktiken beim Umgang mit Fleisch
Mehr Informationen
Virtuelle Tiere
Schauplätze codierter Natürlichkeit
Mehr Informationen
Kuh
180° – 330° – 360° – Annäherungen an tierliche Perspektiven und Wahrnehmungsweisen
Mehr Informationen
When I touch the person on the screen
Der digitale Körper zwischen Materialität und Virtualität
Mehr Informationen
Sartre, Unaufrichtigkeit und Authentizität in digitalen Selbstverhältnissen
Mehr Informationen
Editorial
Mehr Informationen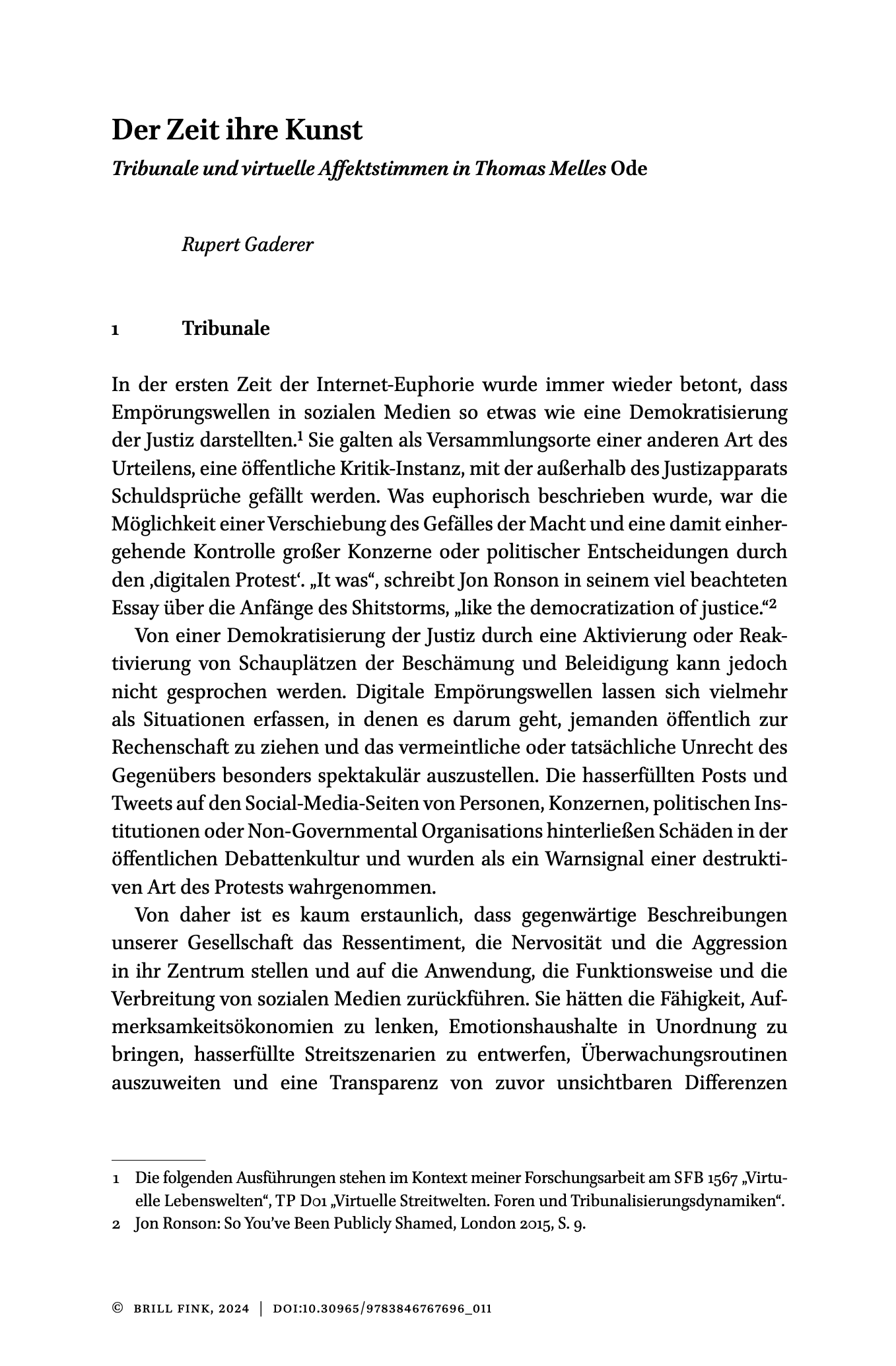
Der Zeit ihre Kunst
Tribunale und virtuelle Affektstimmen in Thomas Melles Ode
Mehr Informationen
Arrest Matters
The Pragmatics of Vulnerability in Phone Calls to the Stasi
Mehr Informationen
Virtuelles Fernsehen
Transformationen jenseits des Computerbildes
Mehr Informationen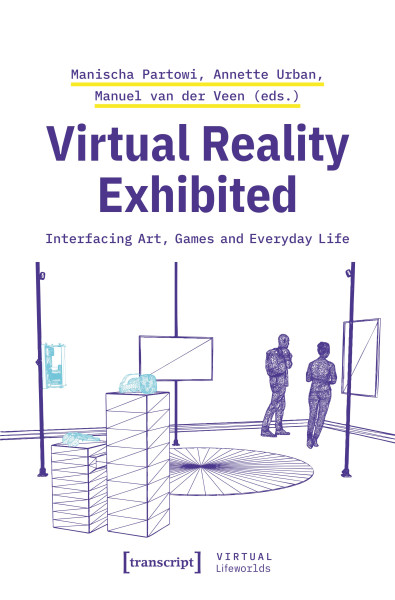
Virtual Reality Exhibited
Interfacing Art, Games and Everyday Life
Mehr Informationen
Virtuelle Landschaften
Raumerkundungen an der Grenze des Screens
Mehr Informationen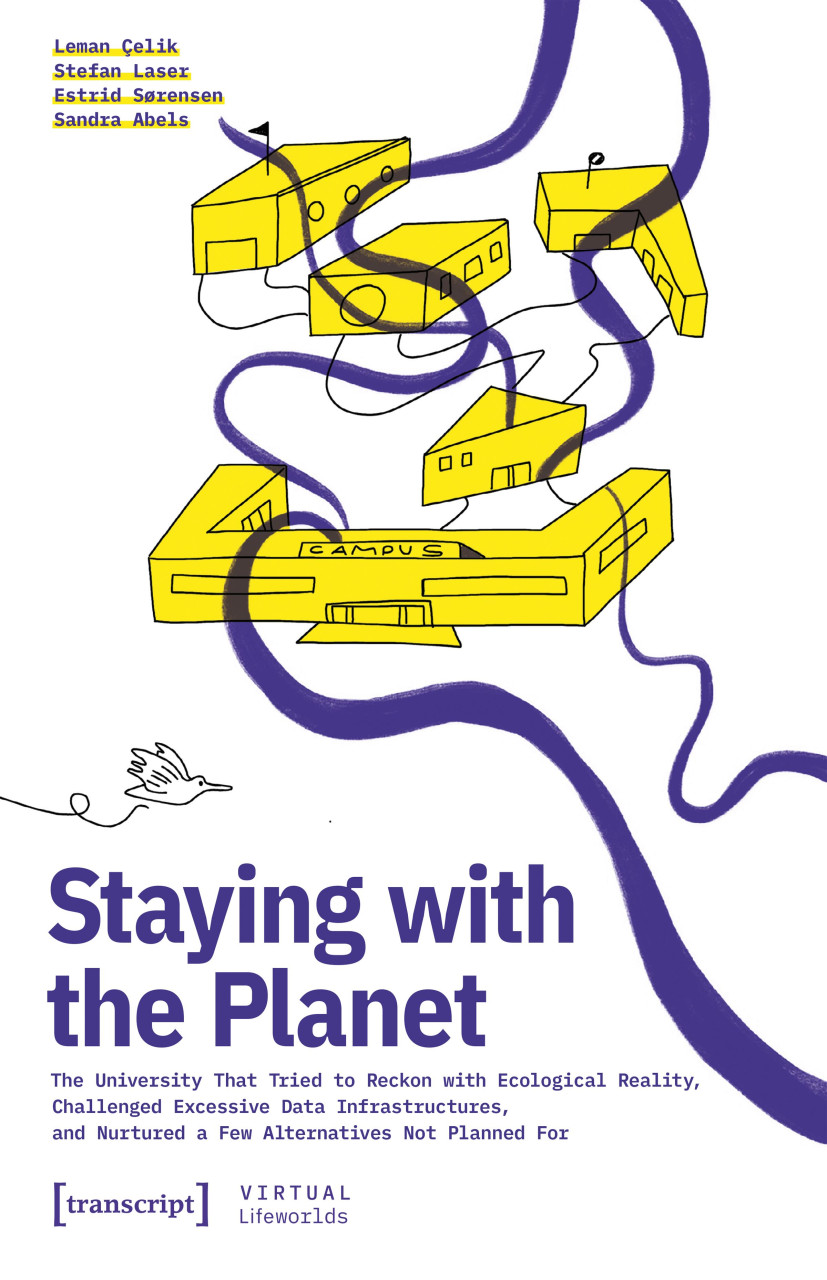
Staying with the Planet
The University That Tried to Reckon with Ecological Reality, Challenged Excessive Data Infrastructures, and Nurtured a Few Alternatives Not Planned For
Mehr Informationen
Forensisches Auftreten
Postdigitale Mediengefüge an den Rändern der Justiz
Mehr Informationen.jpg)
Virtuelle Universität
Geistes- und gesellschaftswissenschaftliche Zugänge
Mehr Informationen
Eigensinnige Objekte
Virtuelle Möglichkeitsräume zwischen Aufforderung und Entzug
Mehr Informationen
Postphenomenology and Technologies within Educational Settings
Mehr Informationen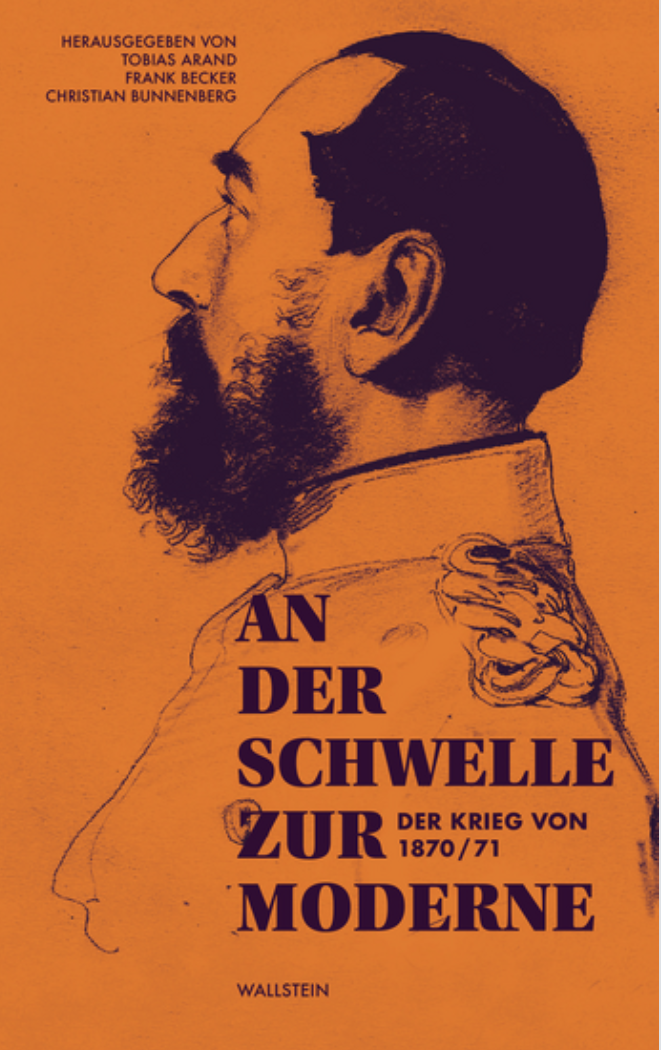
An der Schwelle zur Moderne
Der Krieg von 1870/71
Mehr Informationen
Virtuelles Essen
Interdisziplinäre Perspektiven auf Ernährungspraktiken im digitalen Zeitalter
Mehr Informationen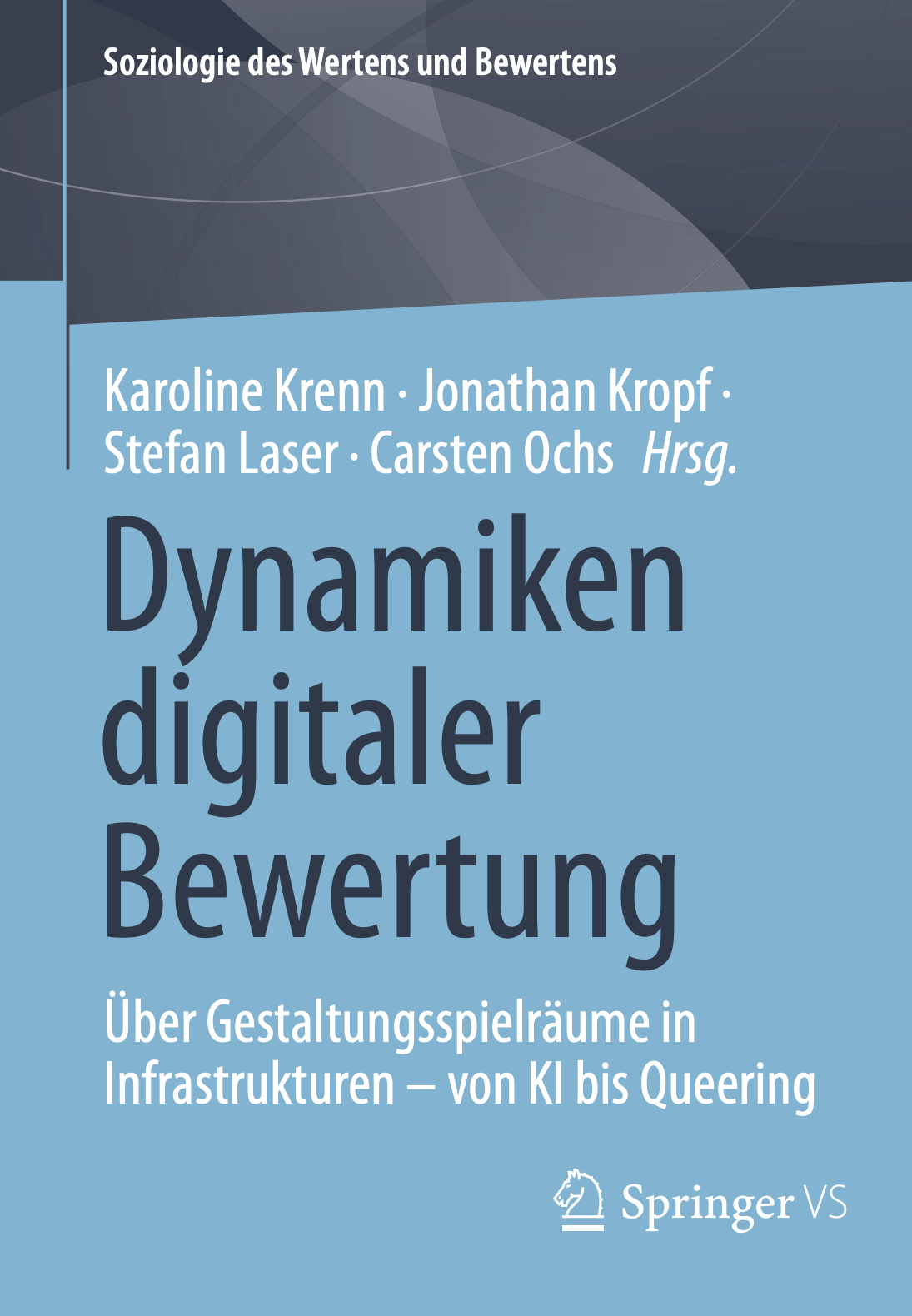
Dynamiken digitaler Bewertung
Über Gestaltungsspielräume in Infrastrukturen – von KI bis Queering
Mehr Informationen
Medien – Bildung – Forschung
Integrative und interdisziplinäre Perspektiven
Mehr Informationen
Virtuelle Tiere
Lebewesen zwischen Code und Kreatur
Mehr Informationen
Vokabular des Virtuellen
Ein situiertes Lexikon
Mehr Informationen
Hass teilen
Tribunale und Affekte virtueller Streitwelten
Mehr Informationen
IMAGE. Zeitschrift für interdisziplinäre Bildwissenschaft
Bild und Augmentation
Mehr Informationen
Bildung und Digitalität
Analysen – Diskurse – Perspektiven
Mehr Informationen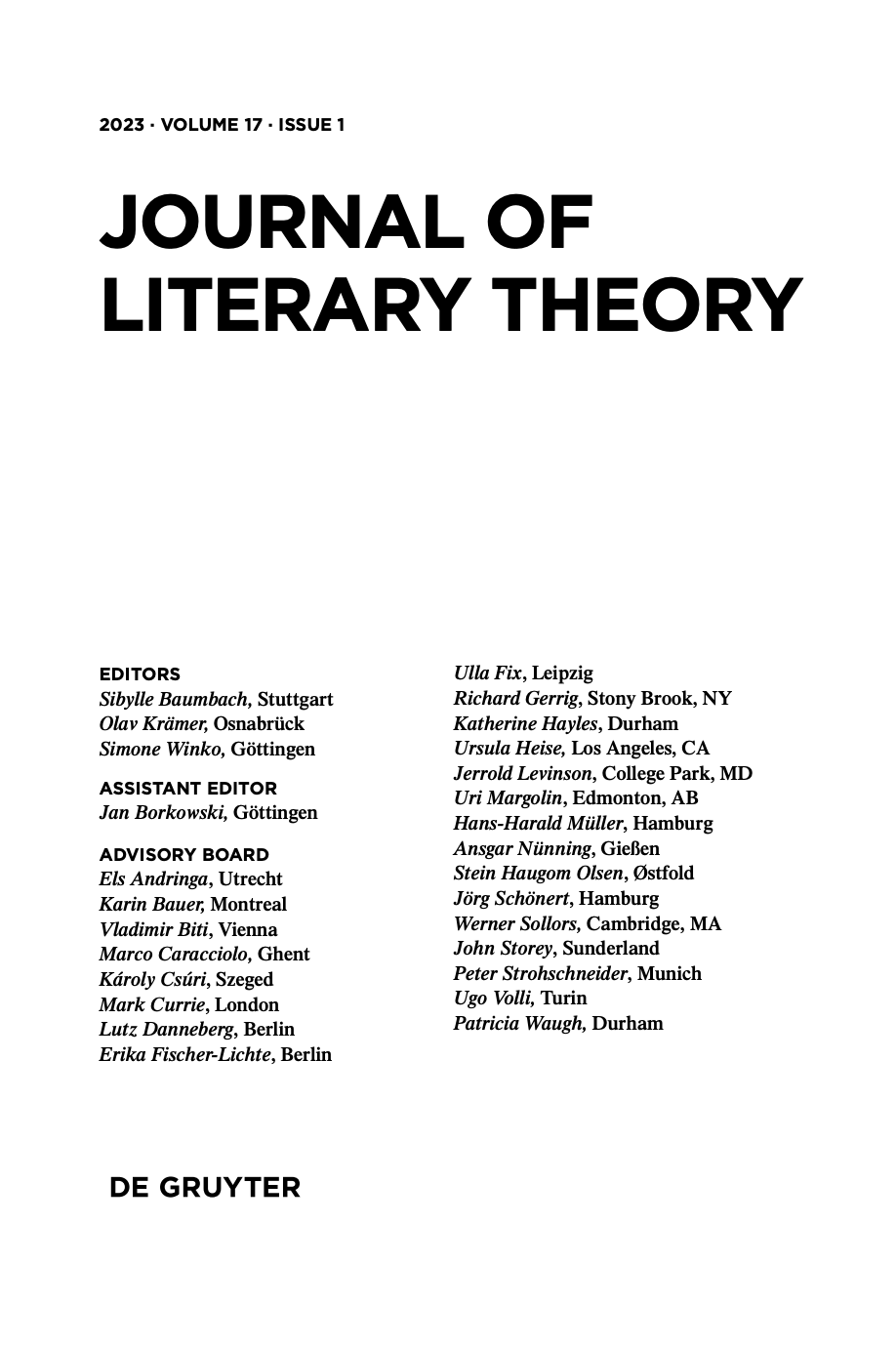
Journal of Literary Theory
Special Issue: Mediating Literature
Mehr Informationen
ChatGPT und andere »Quatschmaschinen«
Gespräche mit Künstlicher Intelligenz
Mehr Informationen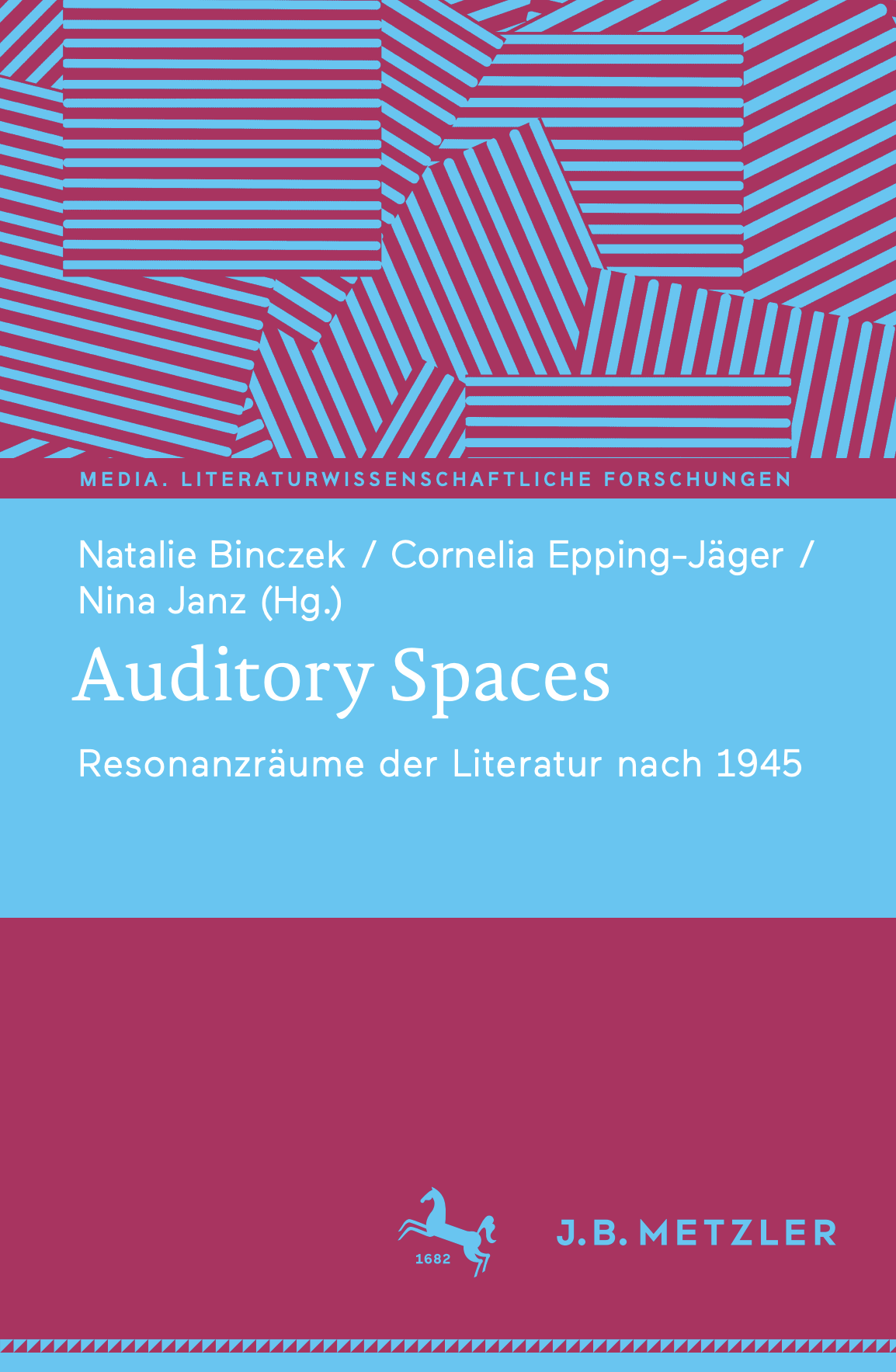
Auditory Spaces
Resonanzräume der Literatur nach 1945
Mehr Informationen
Virtuelle Lebenswelten
Körper – Räume – Affekte
Mehr Informationen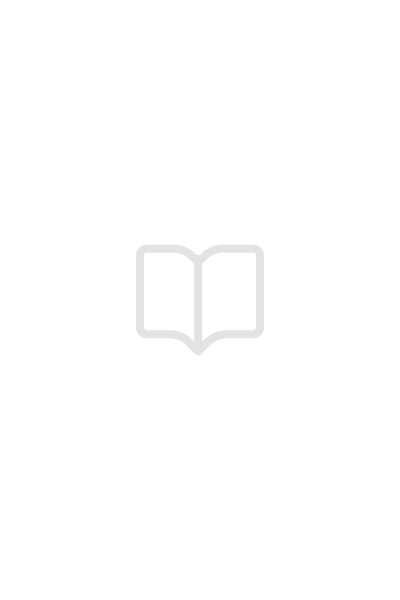
Virtual Image Archives
Logistics, Historicity, Navigation
Mehr Informationen
Augmented und Virtual Reality im Bildungsfokus
Zu diskursiv-materiellen Macht- und Wissensordnungen
Mehr Informationen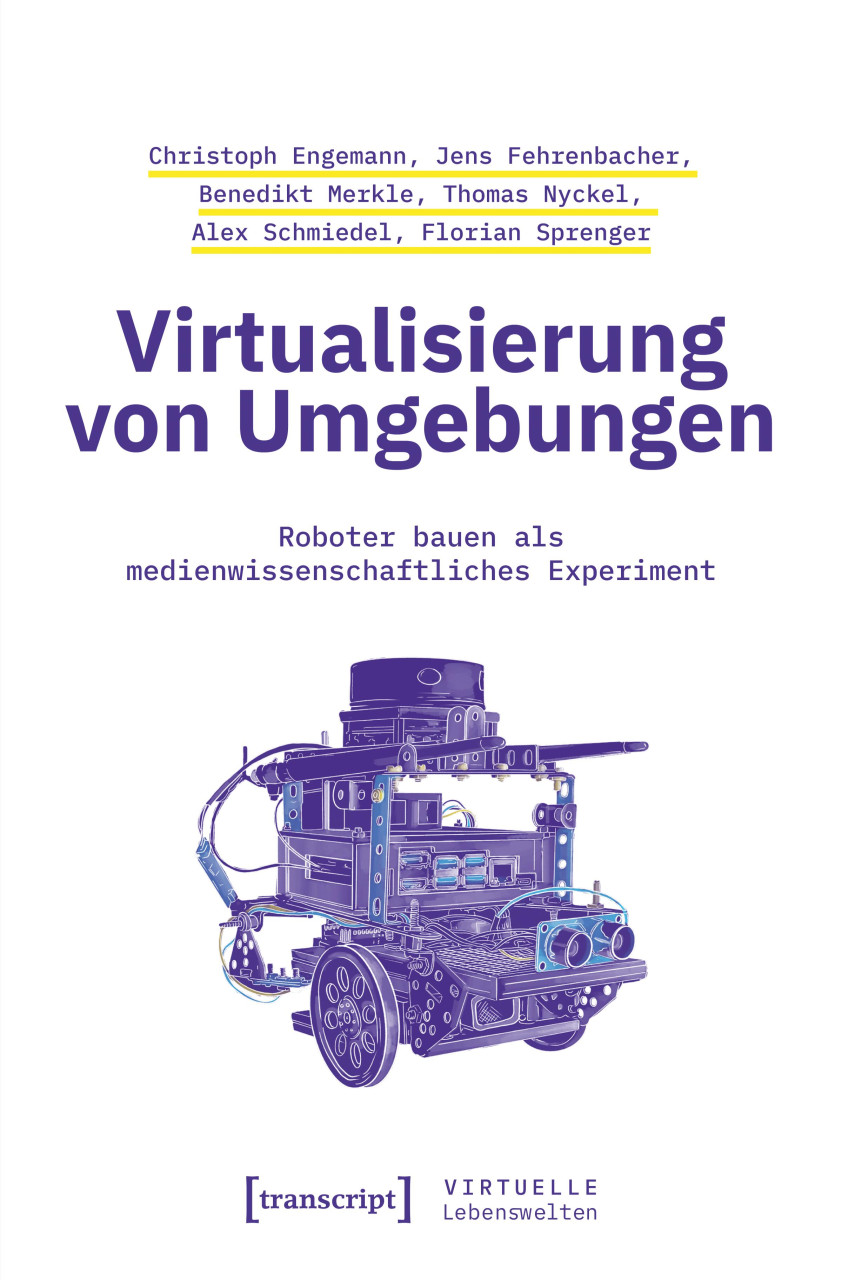
Virtualisierung von Umgebungen
Roboter bauen als medienwissenschaftliches Experiment
Mehr Informationen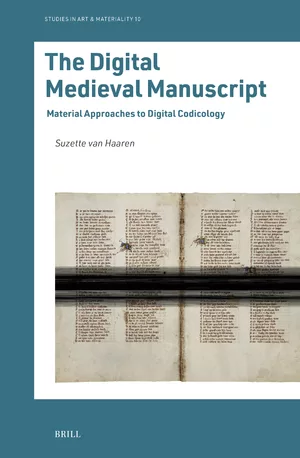
The Digital Medieval Manuscript
Material Approaches to Digital Codicology
Mehr Informationen
Augmented Reality
Für eine Kunstgeschichte der Kollision von Bild und Umgebung
Mehr Informationen
Die private und die verteilte Person
Studien zu Personalisierung und Privatheit in Zeiten der Digitalisierung
Mehr Informationen
Fragile Evidenz
Videodokumente illegaler Zurückweisungen an Europas Grenzen
Mehr Informationen
Virtuelle Realitäten als Geschichtserfahrung (ViRaGe)
Real or really unreal? VR und historisch-politische Bildung in der Schule, an Erinnerungsorten und im Internet
Mehr Informationen
Lidar on wheels
Mehr Informationen
White Paper „Digital-historisch Promovieren“
Ergebnisse des Kickoff-Retreats des NFD4Memory Promovierendennetzwerks Digital History. Version 1.0
Mehr Informationen
The Power of Storytelling – Geschichten digital erlebbar machen
Gewinn der 33. Runde des eLearning-Wettbewerbs 5x5000 der RUB
Mehr Informationen
Scrolling war gestern
Ist die Apple Vision Pro einfach ein neues Spielzeug? Oder doch ein völlig neuer Umgang mit Computern?
Mehr Informationen
Soziale Medien als accidental archives
Ein Gespräch mit Maria Mingo (Mnemonic)
Mehr Informationen
D wie digital — D wie demokratisch
Implementierung immersiver VR-Anwendungen in der ersten Phase der Lehrer:innenbildung zur Förderung demokratiebildender geschichtsdidaktischer Kompetenzen
Mehr Informationen
The past as it (virtual) really was?
Immersive VR applications as a new medium of collective memory: authenticity, plausibility, trust
Mehr Informationen
Was tun in und mit Bildern?
Handlungsformen in Augmented und Virtual Reality
Mehr Informationen
Forschung (be-)schreiben
Medienwissenschaftliche Laborbücher
Mehr Informationen
Lab Books
Mehr Informationen
Roboter bauen, Programmieren lernen, digitale Kulturen verstehen
Mehr Informationen
Augmenting the City, Augmenting the Museum
Strategien des Kunstausstellens mit AR
Mehr Informationen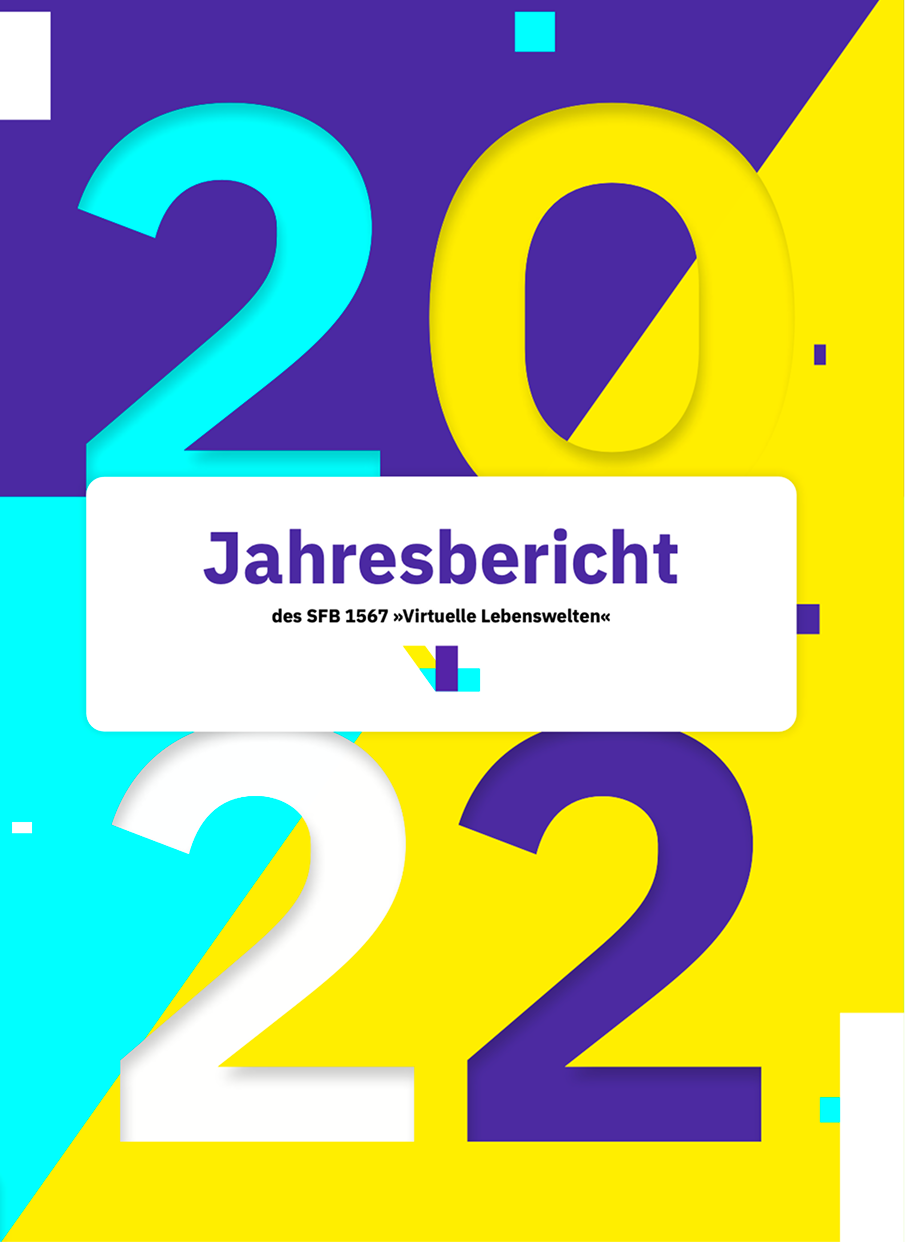
Jahresbericht 2022
Überblick der Tätigkeiten des SFB von März 2022 bis Dezember 2022
Jetzt herunterladen
Jahresbericht 2023
Überblick der Tätigkeiten des SFB von Januar 2023 bis Dezember 2023
Jetzt herunterladen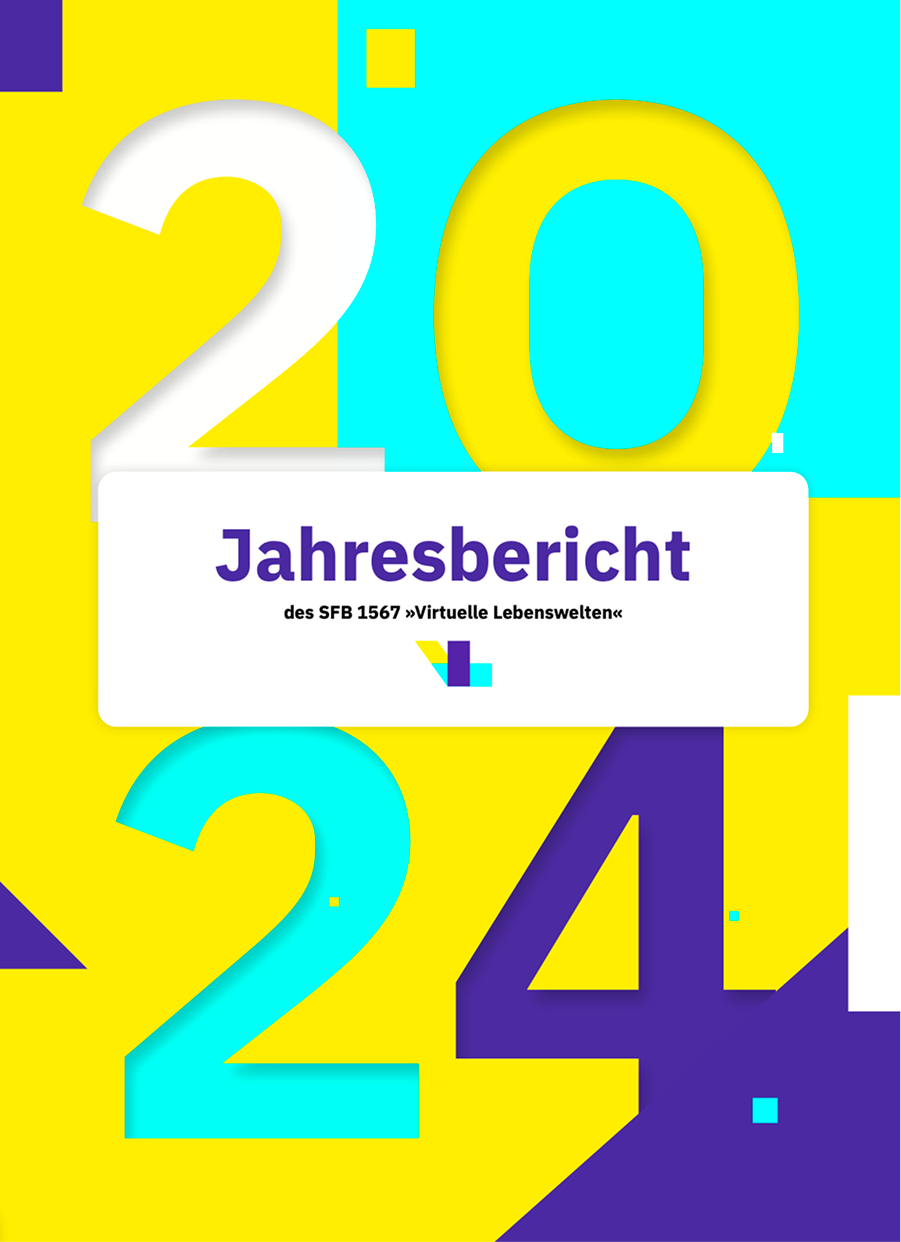
Jahresbericht 2024
Überblick der Tätigkeiten des SFB von Januar 2024 bis Dezember 2024
Jetzt herunterladen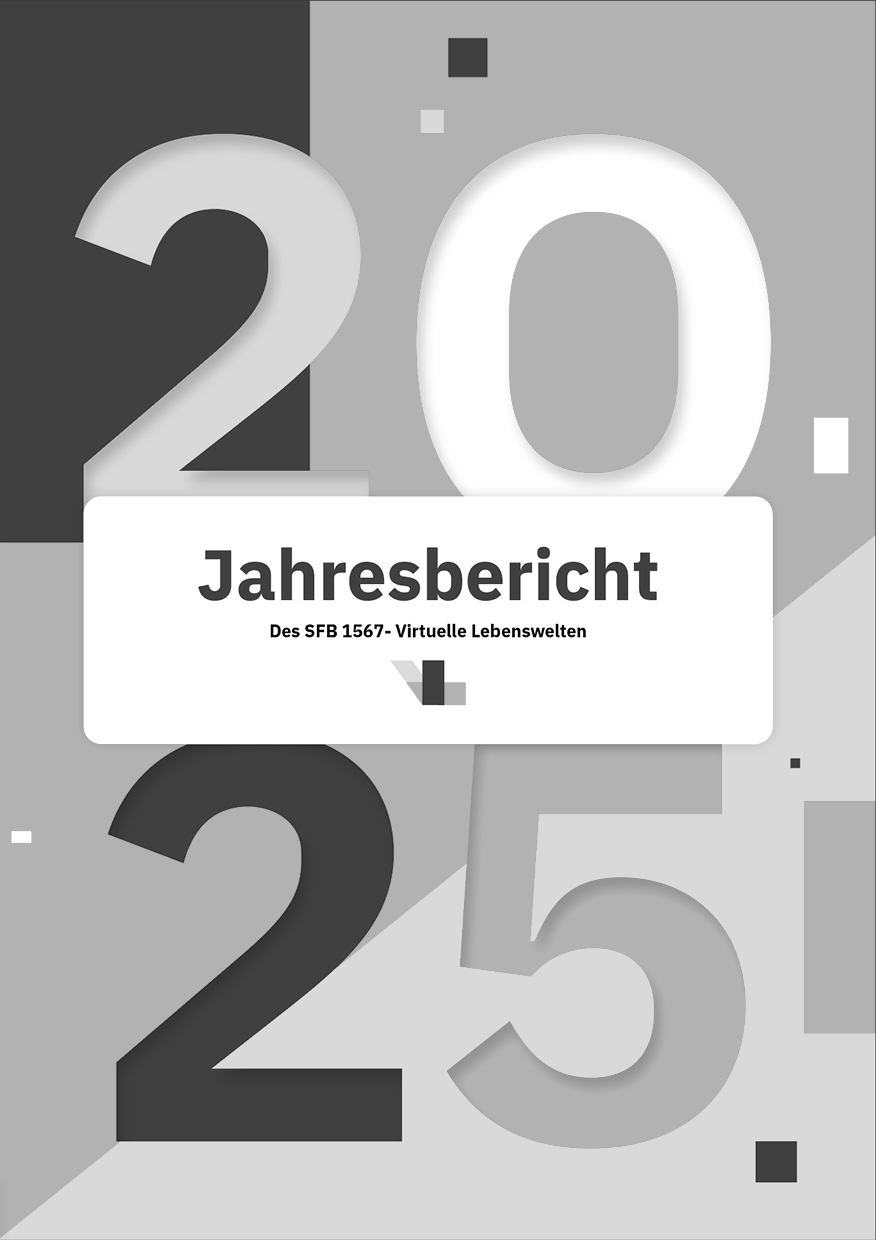
Jahresbericht 2025
Überblick der Tätigkeiten des SFB von Januar 2025 bis Dezember 2025
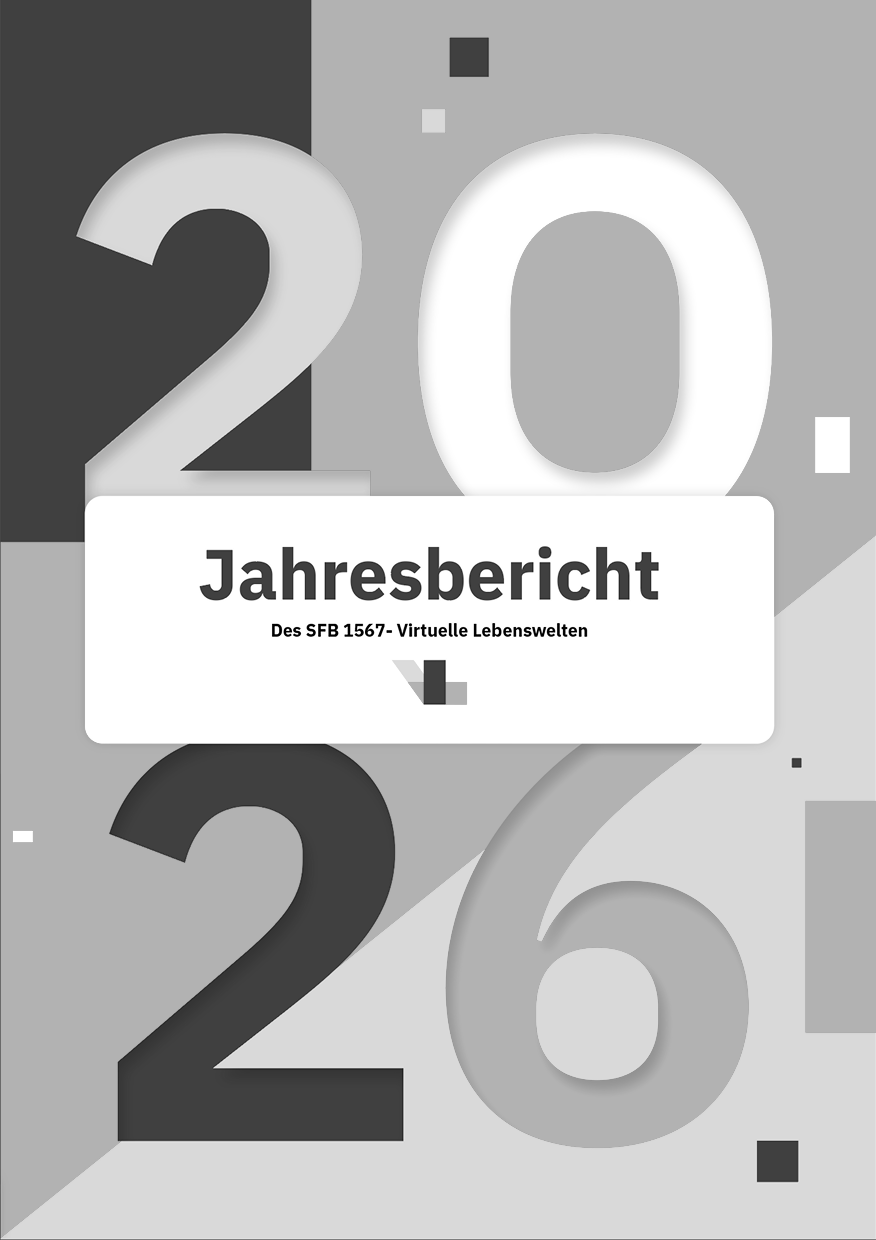
Jahresbericht 2026
Überblick der Tätigkeiten des SFB von Januar 2026 bis Dezember 2026